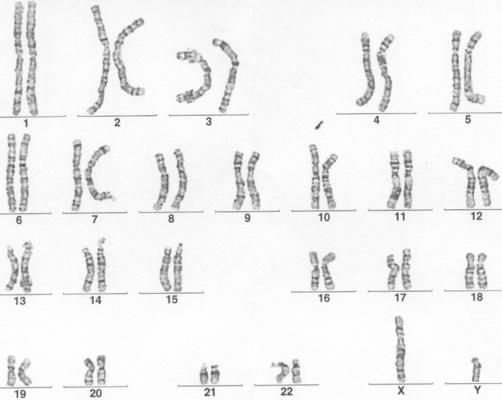Das Interview wurde auf englisch geführt und stand zunächst nur in der Originalfassung zur Verfügung.
Die Genforschung liefert Einsichten, die sowohl von als auch gegen Rassist*innen angeführt werden. So widerlegt sie einerseits, dass Menschen aus allen Teilen der Welt sich genetisch so stark ähneln, dass von "Rassen" nicht gesprochen werden kann. Das hindert diejenigen, die aber trotzdem daran glauben mögen nicht daran, sich auf Unterschiede zwischen sogenannten "Populationen" zu beziehen um zu beweisen, dass es eben doch fundamentale Unterschiede gebe.
Die Biologin, Politik- und Sozialwissenschaftlerin Jenny Reardon forscht seit 27 Jahren über die gesellschaftliche Rolle der Genforschung und ist eine von über 80 Mitunterzeichnerinnen eines Artikels, der sich gegen eine solche Argumentation richtete. Er stellte eine Antwort auf eine Kolumne des Genetikers David Reich dar, der in der New York Times für eine verstärkte Diskussion des Konzepts "Rasse" als Forschungskategorie eintrat.
Wir sprachen mit Jenny Reardon über das Spannungsverhältnis in dem sich die Genforschung bewegt, weshalb genetische Unterschiede zwischen Menschen beforscht werden sollten und wie das ohne Rassismus möglich sein kann.
Jenny Reardon ist Professorin an der Universität von Kalifornien (Santa Cruz) und Leiterin des dortigen Science & Justice Research Centers. Zur Zeit ist sie als Trägerin des Friedrich Wilhelm Bessel Preises der Alexander von Humboldt Stiftung auf Forschungsbesuch in Deutschland und kürzlich erschien ihr neues Buch "The Postgenomic Condition" (University of Chicago Press 2017) in dem sie sich den Entwicklungen der letzten zehn Jahre seit dem "Human Genome Project" widmet, das die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms erreichte.